4.5 Das Leben in der Siedlung
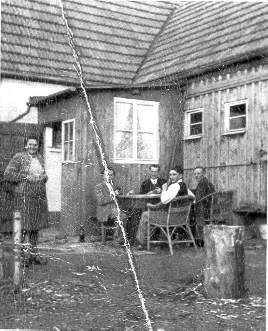 Das
Leben in der Siedlung war trotz der eigentlich günstigen Bedingungen nicht
beneidenswert. (73) Die meisten Siedler waren einfache Arbeiter und hatten
zwischen zwei und vier Kinder (74). Es standen ihnen einerseits relativ
große Gärten zur Verfügung, in denen sie Obst und Gemüse anbauen konnten.
Weiterhin hatten sie einen Stall, in dem sie Ziegen, Hasen, Gänse, Enten
und Hühner hielten. Sie waren also durchaus in der Lage, sich weitgehend
selbst zu versorgen. Andererseits war die Siedlung nicht an das Kanalisationssystem
angeschlossen, und das Schmutzwasser wurde einfach in einen Graben vor
dem Gartentor geschüttet. Fließendes Wasser gab es nur in der Küche. Der
Strom war bis ins Erdgeschoß verlegt worden und konnte nur durch einen
Münzautomaten für Groschen genutzt werden. So konnte es durchaus passieren,
daß man sich, wenn man in der Nacht nach Hause kam und kein Kleingeld
mehr hatte, im Dunkeln ausziehen und ins Bett gehen mußte. In die Stadt
führten nur Feldwege oder Schotterstraßen, und die Entfernung war ziemlich
groß. Da die Siedler aus ärmeren Verhältnissen kamen, hatten sie im Normalfall
kein Auto und mußten die Strecke entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß
zurücklegen. Vor allem für die Frauen war dies ein großer Nachteil, da
sie zum Einkaufen rund zwei Kilometer meist zu Fuß laufen mußten. Auch
die Kinder hatten teilweise unter diesen Bedingungen zu leiden. Sie mußten
jeden Morgen den weiten Weg bis zur Grundschule in der Kronacher Straße
zurücklegen und waren auch noch, da die Siedler als Selbstversorger galten,
von der Schulspeisung ausgeschlossen. Doch trotz oder auch gerade wegen
dieser Nachteile entwickelten die Siedler schon bald ein tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl
untereinander. Sie gründeten einen Siedlerbund, der, wie in anderen Siedlungen
auch, automatisch der DAF angeschlossen wurde. Die Zielsetzung der Nationalsozialisten,
dieses Gemeinschaftsgefühl in eine Identifikation mit der "Volksgemeinschaft"
zu überführen, war aber wohl weitgehend eine Wunschvorstellung. Das
Leben in der Siedlung war trotz der eigentlich günstigen Bedingungen nicht
beneidenswert. (73) Die meisten Siedler waren einfache Arbeiter und hatten
zwischen zwei und vier Kinder (74). Es standen ihnen einerseits relativ
große Gärten zur Verfügung, in denen sie Obst und Gemüse anbauen konnten.
Weiterhin hatten sie einen Stall, in dem sie Ziegen, Hasen, Gänse, Enten
und Hühner hielten. Sie waren also durchaus in der Lage, sich weitgehend
selbst zu versorgen. Andererseits war die Siedlung nicht an das Kanalisationssystem
angeschlossen, und das Schmutzwasser wurde einfach in einen Graben vor
dem Gartentor geschüttet. Fließendes Wasser gab es nur in der Küche. Der
Strom war bis ins Erdgeschoß verlegt worden und konnte nur durch einen
Münzautomaten für Groschen genutzt werden. So konnte es durchaus passieren,
daß man sich, wenn man in der Nacht nach Hause kam und kein Kleingeld
mehr hatte, im Dunkeln ausziehen und ins Bett gehen mußte. In die Stadt
führten nur Feldwege oder Schotterstraßen, und die Entfernung war ziemlich
groß. Da die Siedler aus ärmeren Verhältnissen kamen, hatten sie im Normalfall
kein Auto und mußten die Strecke entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß
zurücklegen. Vor allem für die Frauen war dies ein großer Nachteil, da
sie zum Einkaufen rund zwei Kilometer meist zu Fuß laufen mußten. Auch
die Kinder hatten teilweise unter diesen Bedingungen zu leiden. Sie mußten
jeden Morgen den weiten Weg bis zur Grundschule in der Kronacher Straße
zurücklegen und waren auch noch, da die Siedler als Selbstversorger galten,
von der Schulspeisung ausgeschlossen. Doch trotz oder auch gerade wegen
dieser Nachteile entwickelten die Siedler schon bald ein tiefes Zusammengehörigkeitsgefühl
untereinander. Sie gründeten einen Siedlerbund, der, wie in anderen Siedlungen
auch, automatisch der DAF angeschlossen wurde. Die Zielsetzung der Nationalsozialisten,
dieses Gemeinschaftsgefühl in eine Identifikation mit der "Volksgemeinschaft"
zu überführen, war aber wohl weitgehend eine Wunschvorstellung.
Der Gründer und Leiter des Lichtenfelser Siedlerbundes -Becker war der
heimliche Bürgermeister der Siedlung. Er besorgte für die Siedler Gartenwerkzeuge,
Düngemittel und ähnliches in größeren Mengen und stellte es so billiger,
als es anderswo zu haben war, zur Verfügung. Zu ihm gingen die Siedler,
wenn sie Probleme hatten.
Bei den Lichtenfelsern hatten die Bewohner am Klentsch allerdings oft
einen schlechten Ruf. Wenn etwas angestellt worden war, hieß es gleich:
"Ach, bestimmt wieder ein Siedler". Diese ungerechten Diffamierungen dürften
wohl mit zum Zusammengehörigkeitsgefühl der Betroffenen beigetragen haben.
Allen Problemen zum Trotz setzte sich die Siedlung bald als eigenständiger
Teil von Lichtenfels durch. Vor allem in den Kriegsjahren wurden die Siedler
um ihre Gärten und Tiere beneidet.
|