|
Als Hitler 1933 Reichskanzler wurde, herrschte noch immer eine große
Arbeitslosigkeit. Da sich die Wählerschaft der NSDAP vor allem aus Arbeitern,
Angestellten und Angehörigen des Kleinbürgertums (25) zusammensetzte,
mußte eine Politik betrieben werden, die zumindest dem äußeren Anschein
nach allen Bevölkerungsgruppen gerecht wurde.
3.1 Zielsetzungen der Siedlungspolitik
Aufgrund der wirtschaftlichen Situation ergaben sich für den nationalsozialistischen
Siedlungsbau die gleichen grundlegenden Ziele wie in der Weimarer Republik.
Zunächst war das Wichtigste "die Verringerung der Arbeitslosenzahl" (26).
Trotz eines "Fehlbedarfs von fast 1 Million Wohnungen" (27) wurde erst
in andere Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen investiert wie z.B.. den Autobahnbau.
Da das Parteiprogramm der NSDAP kein eigenes wohnungspolitisches Programm
enthielt, übernahm man die Weimarer Wohnungspolitik, obwohl es aus den
Reihen der Nationalsozialisten starke Kritik an der vorstädtischen Kleinsiedlung
gab. Die Zielsetzung war aber im großen und ganzen übereinstimmend: die
"Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mit möglichst geringer Investitionsmenge",
die "Seßhaftmachung der Bevölkerung" und die "Ankurbelung der Bauwirtschaft"
(28)
Aus der Tabelle S.13 ergibt sich jedoch klar der geringe Stellenwert,
den die Siedlungsförderung für den Nationalsozialismus im Vergleich zur
Weimarer Republik hatte: Wie in den meisten Bereichen der Sozialpolitik
widersprach die Realität dem, was die NSPropaganda als große Erfolge des
neuen Systems anpries. Sowohl die Zahl der Neusiedler als auch die zur
Verfügung gestellte Fläche ging im Vergleich zur vielgeschmähten Weimarer
Republik kontinuierlich und stark zurück. Dies ist besonders deutlich
erkennbar in den Jahren der militärischen Hochrüstung seit 1935.
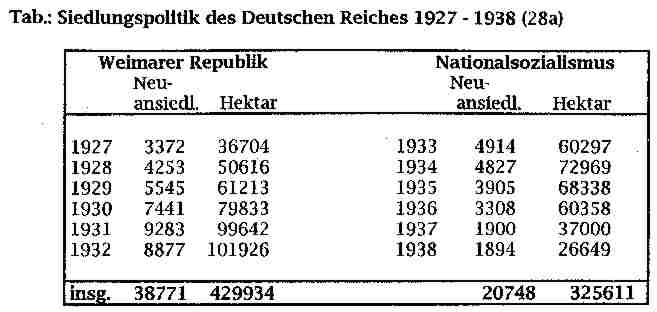
3.2 Verwirklichung der Siedlungspläne
Der Siedlungsbau im Nationalsozialismus läßt sich in drei große Abschnitte
gliedern: Im ersten Abschnitt von 1933 bis 1935/36 übernahm das Dritte
Reich im wesentlichen die Planungen der Weimarer Republik und versuchte,
sie mit nationalsozialistischer Ideologie zu überformen. Dann, 1936 -
1939/40, wurde die Siedlung eng in die Organisation der DAF eingegliedert,
und das Reich dehnte, ähnlich wie in der Wirtschaft, auch im Wohnungsbau
die Möglichkeit staatlicher Lenkung weiter aus. (29) Der dritte und letzte
Teil von 1940 bis 1943 stand im Zeichen des Krieges. In diesem Abschnitt
wurden bereits Entwürfe für Siedlungen nach einem gewonnenen Krieg, z.
B. in der "Ostmark" (Österreich), gemacht. (30) Hier soll aber nur die
erste Phase, 1933 - 1935/36, näher besprochen werden, da die anderen für
die Stadtrandsiedlung Lichtenfels so gut wie keine Bedeutung hatten.
3.2.1 Organisation und Verwaltung
Zur Durchführung des Siedlungsprogramms wurden auf Reichsebene zwei Stellen
eingerichtet: das Reichssiedlungskommissariat, das von Gottfried Feder
geleitet wurde, und das Reichsheimstättenamt unter der Führung von J.
W. Ludowici, der gleichzeitig "Siedlungsbeauftragter im Stabe des Stellvertreters
des Führers" und "Stellvertreter des Reichskommissars" (31) war. (32)
Das Reichssiedlungskommissariat setzte sich aus allen "mit dem Wohnungswesen
und dem nichtbäuerlichen Siedlungswesen zuständigen behördlichen Stellen"
(33) zusammen. Das Reichsheimstättenamt war hierarchisch, dem Führerprinzip
entsprechend, aufgebaut und sollte "die nationalsozialistische Zielsetzung
der Siedlungspolitik garantieren" (34). Es gehörte sowohl der NSDAP als
auch der DAF an, und seine Mitarbeiter waren langjährige und überzeugte
Parteimitglieder.
3.2.2. Ideologische Überformung
Die Kritik der Nationalsozialisten an den Planungen der Weimarer Republik
richtete sich gegen die Lage der Siedlungen - am Rand von Großstädten
-, die einfache und vor allem billige Bauausführung der Häuser, die Auswahl
der Siedler und deren Beschränkung auf Erwerbslose. (35)
An der Lage wurde die Auswahl des Geländes für die ländlichen Siedlungen,
das für eine gewinnbringende Bewirtschaftung nur schlecht geeignet war,
bemängelt. Auch die Ansiedlung der Erwerbslosen am Stadtrand löste scharfe
Kritik aus, da die Arbeitslosen aufgrund der abgeschiedenen Lage kaum
die Möglichkeit hatten, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Die kostspielige
Aufschließung des Siedlungsgeländes bei der im Vergleich zu großstädtischen
Mietanlagen dünnen Besiedlung bot einen weiteren Angriffspunkt. Letztlich
wurde dann auch noch bemängelt, "Primitivsiedlungen dieser Art" stünden
der planmäßigen Ausweitung und Ausgestaltung der Städte entgegen" (36)
und schadeten "dem Ansehen der Städte" (37). An der primitiven Bauausführung
der Häuser wurde kritisiert, daß die "Lebensdauer (...) nicht im Einklang
zu den nötigen Aufschließungskosteri" (38) stehe. Schließlich bemängelte
man die Auswahl der Siedler nach Kriterien wie der Arbeitslosigkeit oder
auch dem früheren Beruf (bevorzugt Maurer u. ä. wegen der Eigenleistungen).
Trotz dieser starken Kritik konnte die NSDAP es sich wegen des großen
Zuspruchs in der Bevölkerung nicht leisten, das Siedlungsprogramm abzusetzen.
Deshalb wurde die Gestaltung der NS-Ideologie angepaßt. Hier gab es sechs
Grundmotive (39):
- die Gemeinschaftsideologie, ausgedrückt in der Betriebsgemeinschaft,
der Siedlungsgemeinschaft und schließlich in der Volksgemeinschaft,
- die Autoritätsideologie, realisiert im Führerprinzip,
- die "Blut und Boden"-Ideologie, repräsentiert durch
die "natürliche" Organismustheorie, die Glorifizierung des Bauerntums,
der "Heimat",
- die "Sündenbockphilosophie" die in Verbindung mit
der "völkischen" Rassenlehre ein Feindbild aufbaut, das für alle übel
verantwortlich gemacht werden kann und den Massen Objekte liefert,
an denen sie ihre Aggressionen entladen können,
- die Eigentumsideologie, d.h. das Festhalten am Privateigentum
als Grundlage des Wirtschaftssystems, und
- den Militarismus, der die Bevölkerung ideologisch
auf den Krieg vorbereitete." (40)
Nach diesen Grundmotiven sollte nun die Siedlung der Weimarer Republik
zu einer im Dienst der Ideologie stehenden nationalsozialistischen Siedlung
werden.
Die "Gemeinschaftsideologie" (41) sollte durch den engen Nachbarschaftskontakt
verwirklicht werden. Die Siedler konnten das Geschehen innerhalb der Siedlung
überblicken und fühlten sich dadurch integriert. Dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit
sollte sich nach den Vorstellungen der NS-Ideologen übersetzen in eine
Integration in die nationalsozialistische "Volksgemeinschaft",
Die "Autoritätsideologie" (42) wurde nur in der Organisation und der
Verwaltung des Siedlungswesens realisiert (Reichsheimstättenamt).
Die "'Blut und Boden'-Ideologie" (43) spiegelte sich in der Forderung
nach Grün und der Verwendung von überwiegend natürlichen Baustoffen wider.
Die Arbeit auf der "eigenen Scholle", so hofften die NS-Ideologen, würde
die Siedler zurückführen zu einer naturverwachsenen, bodenständigen und
als "moralisch gesund" verstandenen Lebensauffassung führen. Auch der
Mythos der "Heimat" (44) kam hier wieder zur Geltung. Er sollte durch
die Gemeinschaft in der Siedlung und das Gefühl, Eigentümer seines Anwesens
zu sein ("Eigentumsideologie" (45)), vermittelt werden.
Das beherrschende Motiv der äußeren Gestaltung der Siedlung war neben
der "'Blut und Boden'-Ideologie" (46) (z. B. steiles Dach analog zur Bauweise
vieler alter Bauernhaustypen) vor allem der "Militarismus" (47). Die Anordnung
der Häuser in "'Reih und Glied' entlang der Siedlungsstraßen' (48) und
die Uniformität der Anlage, speziell der Siedlerstellen, sollten die Bevölkerung
"unbewußt an die militärische Ausrichtung der Organisation" (49) gewöhnen.
Daß die Umsetzung dieser ideologischen Ziele in der Realität in größerem
Umfang gelungen wäre, darf wohl bezweifelt werden.
3.2.3 Die verschiedenen Typen der Siedlung
Es gab vier verschiedene Siedlungstypen: die Kleinsiedlung, die Eigenheimsiedlung,
die Mietwohnungssiedlung und die Gemeinschaftssiedlung. (50) Die Kleinsiedlung
war eine eher ländliche Siedlung, bei der das eigentliche Siedlergrundstück
nicht kleiner als 600 m2 sein sollte: Es war ja für gartenbaumäßige Nutzung
vorgesehen. Die Kleinsiedlung hatte ein sehr monotones Erscheinungsbild,
das auf die Tatsache zurückzuführen war, daß die Bauausführung vor allem
anderen durch das Ziel möglichst geringer Baukosten bestimmt wurde. Ein
anderer Aspekt für diese Gleichförmigkeit lag darin, daß die Stellen anfangs
nach Beendigung des Baus unter den Siedlern verlost wurden. Das änderte
sich aber, da der Siedler durch das Gefühl, an seinem eigenen Haus zu
arbeiten, zu einer qualitätvolleren Arbeit motiviert werden sollte. Bei
den Siedlungshäusern handelte es sich meist um relativ weit auseinanderstehende
Doppel- oder Einzelhäuser. Die Siedlung wurde an der einen Seite meist
von einer Straße abgegrenzt und endete "häufig in der Form eines Bogens"
(51). Allerdings waren die Siedlerstellen nicht an das Kanalisationsnetz
der Stadt angeschlossen, und der allgemeine Lebensstandard war somit sehr
schlecht.
Eine andere, der Kleinsiedlung aber sehr ähnliche Form war die Eigenheimsiedlung,
die sowohl einheitliche als auch gemischte Bebauung aufwies. Bei der Eigenheimsiedlung
mit einheitlicher Bebauung stand nicht mehr der Gartenbau im Vordergrund,
sondern viehmehr das Wohnen. Die Wohnfläche war größer als die der Kleinsiedlung
und der Wohnkomfort höher. Die Häuser hatten Anschluß an das städtische
Kanalsystem und eine gute Verbindung zur Stadt. Trotzdem wurde auch hier
auf geringe Baukosten größter Wert gelegt. Die Eigenheimsiedlung mit gemischter
Bebauung sprach vor allem die Mittelschicht an. Die Häuser wurden individuell
gestaltet und erlangten den Wert eines Statussymbols. Das Gelände zeichnete
sich durch die nahe Lage zum Stadtzentrum und die gute Infrastruktur aus.
Der Typ der Mietwohnungssiedlung wurde mit dem wirtschaftlichen
Aufschwung "zum neuen Wohnungsideal für Minderbemittelte" (52). Es handelte
sich hierbei meist um Wohnblocks.
Der vierte Siedlungstyp war die Gemeinschaftssiedlung. In ihr
sollten "alle Gebäudeformen und -typen und Wohnungstypen und damit auch
unterschiedliche Bewohnergruppen" (53) zusammengefaßt werden. Diese Siedlungsart
wäre wohl am ehesten in einer Stadt zu verwirklichen gewesen. Die Siedlung
sollte nach außen hin an Bevölkerungsdichte abnehmen. "Die größte Gebäudehöhe
und -dichte befinden sich um das Zentrum herum." (54) Allerdings konnte
aufgrund der "Beschränkung der einzelnen Gebäudetypen und -formen auf
bestimmte Siedlungszonen" keine "Mischung der verschiedenen Bewohnerschichten
erfolgen" (55).
3.2.4 Zur Finanzierung der Kleinsiedlung
Die Kleinsiedlungen wurden anfangs, weil sie ja überwiegend noch Erwerbslosensiedlungen
waren, fast völlig über Reichsdarlehen bezahlt. (56) Da sich der Staat
allmählich aus der Finanzierung der Siedlungen zurückziehen wollte, versuchte
man, den privaten Geldmarkt zu interessieren. Die Kosten für die Siedlerstelle
sollten etwa zwischen 4000 RM und 4500 RM liegen. Das Reich gewährte in
der Regel noch Reichsdarlehen in Höhe von 1500 RM "(4 % Zins + 1 Tilgung)"
(57). Die Dauerfinanzierung, bis zu etwa 60 % (58), erfolgte dann auf
dem privaten Kapitalmarkt durch private erste und - soweit wie möglich
zweite Hypotheken.(59). Die Eigenleistung der Siedler sollte aber mindestens
20 % des Bau- und Bodenwertes (60) betragen. Bei Familien mit vier und
mehr Kindern konnten sie auf 15 % reduziert werden.
"Soweit die Eigenleistungen nicht durch
Beibringung von eigenen Barmitteln oder letztstellig zu sichernden Darlehen
von Verwandten, Betriebsführern usw. aufgebracht werden kann, ist eine
Ergänzung teilweise auch durch eigene Mitarbeit, wie Baugrubenaushub
o. ä., möglich."(61)
Die Kleinsiedlung war "von allen Stempelabgaben, Gebühren und Steuern
des Reiches, der Länder usw., namentlich von Umsatzsteuer, Grunderwerbssteuer
und Wertzuwachssteuer befreit" (62). Weiterhin galten die Siedlerstellen
auch schon "während der ersten 3 Jahre als steuerbegünstigte Eigenheime"
(63). In diesen ersten drei Jahren waren die Siedlerstellen nur auf Probe
gepachtet, und die Miete durfte nicht höher als 25 RM pro Monat sein.
|
Anmerkungen
(25) v g1. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 92 ff.
(26) ebd., S. 98
(27) ebd., S. 99
(28) ebd., S. 101
(28a) Kühnl S. 265
(29) ebd., S. 173
(30) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 5 ff.
(31) ebd., S. 125
(32) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 125 ff.
(33) ebd., S. 125
(34) ebd.
(35) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 110 ff.
(36) ebd. S. 111
(37) ebd.
(38) ebd., S. 111/112
(39) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 417 ff.
(40) ebd. S. 417/418
(41) ebd. S. 417
(42) ebd.
(43) ebd., S. 418
(44) ebd.
(45) ebd.
(46) ebd.
(47) ebd.
(48) ebd., S. 421
(49) ebd.
(50) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 279 / 303
(51) ed., S. 281
(52) ebd., S. 297
(53) ebd., S. 301
(54) ebd., S. 302
(55) ebd.
(56) vgl. Peltz/Dreckmann, 1987, S. 340 - 349, vgl. StadtAL, 672/3
(57) StadtAL, 672/3
(58) ebd.
(59) Peltz/Dreckmann, 1978, S. 345
(60) ebd.
(61) StadtAL, 672/3
(62) ebd.
(63) ebd.
|